Neurofeedback in der Ergotherapie – zwischen Wissenschaft, Intuition und Menschlichkeit
- Hany Branga
- 4. Nov. 2025
- 5 Min. Lesezeit

Erfahrungen von Hany, Ergotherapeutin und Neurofeedbacktherapeutin aus der Grafschaft Bentheim
Einleitung – Wenn Technik zur Therapie wird
Neurofeedback – das klingt für viele zunächst nach Hightech, Kabeln und Computern. Doch wer einmal erlebt hat, wie Menschen durch diese Methode Zugang zu sich selbst finden, spürt schnell: Hier geht es nicht um Maschinen, sondern um Menschlichkeit.
Ich bin Hany, Ergotherapeutin und Neurofeedbacktherapeutin aus der Grafschaft Bentheim. Seit vielen Jahren begleite ich Menschen auf ihrem Weg zu mehr Selbstregulation, Konzentration, innerer Ruhe und Lebensqualität. Dabei verbinde ich klassische ergotherapeutische Ansätze mit modernen neurophysiologischen Verfahren – und einer guten Portion Herz.
Neurofeedback ist kein Ersatz für Ergotherapie, sondern eine Erweiterung. Es vereint wissenschaftliche Erkenntnisse über das Gehirn mit der betätigungsorientierten, klientenzentrierten Haltung unseres Berufs. Es geht darum, Menschen zu befähigen, wieder mehr Kontrolle über sich selbst zu gewinnen – über ihren Körper, ihre Emotionen, ihre Gedanken.
Der Weg zum Neurofeedback
Mein Einstieg in die Welt des Neurofeedbacks war – wie so oft im Leben – eine Mischung aus Zufall, Skepsis und Neugier. Eine Kollegin arbeitete damals bereits mit Neurofeedback, wollte ihre Tätigkeit aber abgeben. Mein damaliger Praxisinhaber fragte, ob ich übernehmen möchte.
Ich hatte zunächst Bedenken. Was ich aus Praktika und Fortbildungen kannte, überzeugte mich nicht: zu technisch, zu wenig Mensch, zu wenig Verständnis dafür, warum etwas im Gehirn trainiert wird. Viele Therapeuten reduzierten sich auf Softwareanwendungen, ohne zu verstehen, was im Hintergrund passiert.
Doch genau das weckte meinen Forschergeist. Ich wollte verstehen, wie Neurofeedback wirkt, welche Mechanismen im Gehirn dabei eine Rolle spielen – und wie ich es sinnvoll in die Ergotherapie integrieren kann.
So begann mein Weg: 2011 absolvierte ich meine Ausbildung am Institut für Neurofeedback in München, später bildete ich mich kontinuierlich fort, arbeitete dort schließlich selbst als Dozentin und entwickelte über die Jahre mein eigenes Konzept: das betätigungsorientierte Neurofeedback.
Neurofeedback in der Praxis – der Mensch im Mittelpunkt
Heute arbeite ich überwiegend mit erwachsenen Patienten – Menschen mit psychischen Erkrankungen, Aufmerksamkeitsproblemen, Schlafstörungen, Burn-out oder dementiellen Symptomen. Früher lag mein Schwerpunkt stärker in der Pädiatrie, doch in den letzten Jahren hat sich die Nachfrage deutlich verschoben.
Die meisten Patienten kommen mit Offenheit und Hoffnung. Vorbehalte entstehen meist nicht durch sie selbst, sondern durch mangelnde Aufklärung im Umfeld – etwa durch skeptische Kollegen oder Ärzte.
Viele glauben anfangs, beim Neurofeedback würde „etwas ins Gehirn gesendet“. Daher beginne ich jedes Erstgespräch mit Aufklärung:„Die Sensoren lesen nur. Es ist eine Einbahnstraße. Es wird nichts stimuliert.“
Ich vermeide bewusst Worte wie Elektroden, die bei manchen an Strom denken lassen. Sprache ist hier bereits Therapie. Denn Vertrauen ist die Basis jeder neurophysiologischen Arbeit – gerade, wenn sie so nah an der Persönlichkeit wirkt wie Neurofeedback.
Meine Patienten sind heute viel informierter als noch vor zehn Jahren. Sie lesen Studien, schauen Videos, informieren sich vorab. Damit steigen auch die Erwartungen – oft in Form abstrakter Ziele: „Ich möchte mich besser konzentrieren können.“Ich helfe ihnen, diese großen Begriffe in kleine, alltagsnahe Ziele zu übersetzen:Was heißt Konzentration für Sie? Wann gelingt sie, wann nicht?So entstehen greifbare, individuelle Therapiepläne – und echte Teilhabe.
Therapiesetting und Alltag – vom EEG zum echten Leben
Neurofeedback braucht Raum – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.In meiner Praxis gibt es eigene Räume für Neurofeedback. Ein geschützter, ruhiger Rahmen ist entscheidend, damit sich Patienten auf den Prozess einlassen können.
Denn Neurofeedback ist keine passive Behandlung. Es fordert aktive Mitarbeit, Aufmerksamkeit und Motivation. Die Atmosphäre trägt entscheidend dazu bei, dass Menschen in Kontakt mit sich selbst kommen.
Technisch arbeite ich mit Systemen von BrainMaster Technologies, die komplexe EEG-basierte Trainings ermöglichen. Doch entscheidend ist nicht die Hardware, sondern der Mensch davor – und der Mensch dahinter.
Ich verstehe mich nicht als Technikerin, sondern als Therapeutin.Ich beobachte, erkläre, begleite. Ich helfe Patienten, die Rückmeldungen des Gehirns zu verstehen – und sie in ihren Alltag zu übertragen.
In einer Sitzung dauert das eigentliche Neurofeedback meist 20–30 Minuten. Vor- und Nachbereitung, Reflexion und Transfer sind ebenso wichtig. Im Verlauf der Therapie rückt der Alltag zunehmend in den Mittelpunkt:Wie lässt sich das Gelernte in Betätigung umsetzen – beim Arbeiten, Kochen, Autofahren, Musizieren oder in sozialen Situationen?
Dieser Transfer ist für mich der Kern ergotherapeutischer Arbeit mit Neurofeedback. Nur so wird Training zu Veränderung.
Betätigungsorientiertes Neurofeedback – mein Konzept
Im Laufe der Jahre habe ich erkannt, dass Neurofeedback allein – so faszinierend es ist – nicht ausreicht. Das Gehirn lernt in Beziehung, im Kontext, in Aktivität.
Deshalb habe ich mein Konzept des betätigungsorientierten Neurofeedbacks entwickelt. Es verbindet die neurophysiologische Arbeit am EEG mit alltagsnahen Aufgaben, Bewegungsübungen und Betätigungen.
Ein Beispiel:Wenn das EEG zeigt, dass die Verbindung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte schwach ist, üben wir anschließend beidhändige oder koordinative Bewegungen. Wir trainieren also das, was das Gehirn zuvor „geübt“ hat – diesmal im echten Leben.
So wird Neurofeedback zu einem Brückenbauer zwischen Gehirn und Alltag.
Eine meiner schönsten Erfahrungen war ein Junge mit Aufmerksamkeitsproblemen. Ich gab ihm als therapeutische Aufgabe, sich um eine Tomatenpflanze zu kümmern – von der Anzucht bis zur ersten Frucht.Er lernte, Verantwortung zu übernehmen, Geduld zu entwickeln und Erfolg nicht sofort, sondern mit Ausdauer zu erleben.Als wir im Sommer gemeinsam die erste Tomate aufgeschnitten haben, war das mehr als ein symbolischer Moment – es war gelebte Neuroplastizität.
Zwischen Evidenz und Erfahrung – das zeitgenössische Paradigma
In der Ergotherapie sprechen wir heute viel vom zeitgenössischen Paradigma – einer Haltung, die Klientenzentrierung, Betätigungsorientierung, Partizipation und Evidenzbasierung vereint.
Ich arbeite nach dieser Haltung, auch wenn ich sie manchmal intuitiv lebe.Neurofeedback fügt sich darin gut ein: Es stärkt Selbstregulation und Selbstwirksamkeit – zentrale Ziele ergotherapeutischer Arbeit.
Dennoch steht die Forschung hier noch am Anfang. Viele Studien sind nicht differenziert genug, um die Vielfalt der Neurofeedbackformen abzubilden.Fragen wie „Hilft Neurofeedback bei Depression?“ sind wissenschaftlich unpräzise – denn welches Neurofeedback ist gemeint? Welche Parameter, welche Protokolle, welches Krankheitsbild?
Ich wünsche mir mehr differenzierte Forschung, die zwischen den Methoden unterscheidet und die Komplexität des Menschen berücksichtigt.Doch bis dahin bleibt unsere klinische Erfahrung ein wertvoller Teil der Evidenz.
Evidenzbasiertes Arbeiten heißt nicht, blind Studien zu folgen, sondern Forschung, Fachwissen und individuelle Erfahrung in Einklang zu bringen.Das ist für mich gelebte Wissenschaft: reflektierte Praxis.
Blick nach vorn – Neurofeedback als Zukunft der Ergotherapie
Die Nachfrage nach Neurofeedback steigt. Immer mehr Menschen suchen Wege, sich selbst besser zu verstehen und zu regulieren – unabhängig von Diagnosen.
In einer Zeit, in der psychische Belastungen zunehmen, bietet Neurofeedback einen Zugang zu Selbststeuerung und innerer Balance. Es passt in den Trend des „Biohackings“, geht aber darüber hinaus – weil es nicht Optimierung, sondern Selbstbegegnung fördert.
Für uns Ergotherapeuten eröffnet das neue Chancen – aber auch Verantwortung.Wir müssen uns fragen: Bleiben wir Therapeuten oder werden wir Techniker?
Ich glaube: Es liegt an uns.Wenn wir Neurofeedback als Werkzeug im Rahmen unseres ergotherapeutischen Denkens nutzen – klientenzentriert, betätigungsorientiert und ganzheitlich – dann verändert es unsere Profession im besten Sinne.
Wir werden zu Begleitern auf einem Weg, auf dem Menschen lernen, mit sich selbst in Beziehung zu treten. Wir werden zu „Bodenaktivatoren“, wie ich es gerne nenne – wir bereiten den Boden, auf dem neues Wachstum möglich wird.
Fazit – Zwischen Gehirn und Herz
Neurofeedback ist für mich keine Maschine, sondern ein Spiegel.Es zeigt Menschen, was in ihnen geschieht – und eröffnet Wege, aktiv Einfluss zu nehmen.
Doch das Wesentliche geschieht nicht auf dem Bildschirm, sondern im Miteinander.In der Haltung, im Gespräch, in der geteilten Neugier auf Veränderung.
Ich sehe mich als Vermittlerin zwischen Körper, Geist und Alltag – als jemand, der Menschen befähigt, ihre Ressourcen zu entdecken.Denn am Ende geht es nicht darum, das Gehirn zu „trainieren“, sondern den Menschen zu stärken.
Und genau das ist – unabhängig von jeder Technologie – das Herz der Ergotherapie.
(Basierend auf einem Experteninterview für die Bachelorarbeit von Carolin Czaplenski und Jannis Kollek an der Zuyd Hogeschool, 2025.)
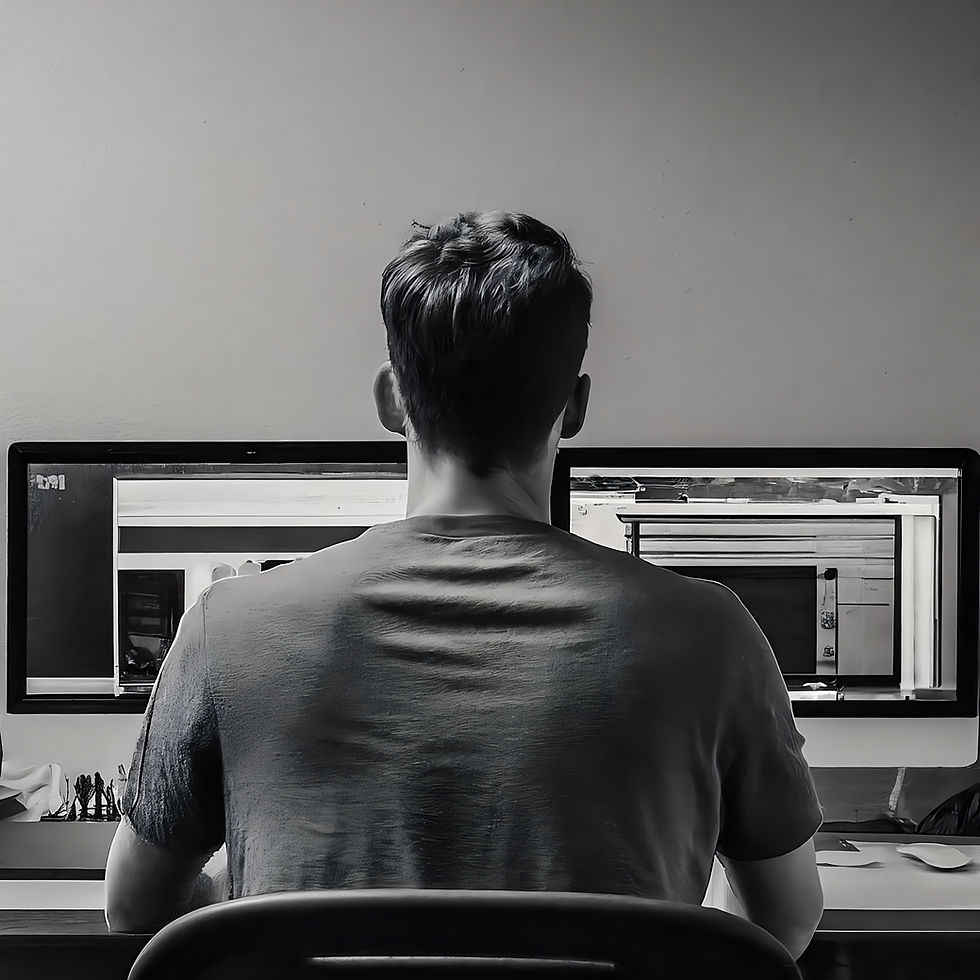

Kommentare