Was macht die i-Technologie wirklich mit unserem Gehirn?
- Hany Branga
- 29. Okt. 2025
- 6 Min. Lesezeit
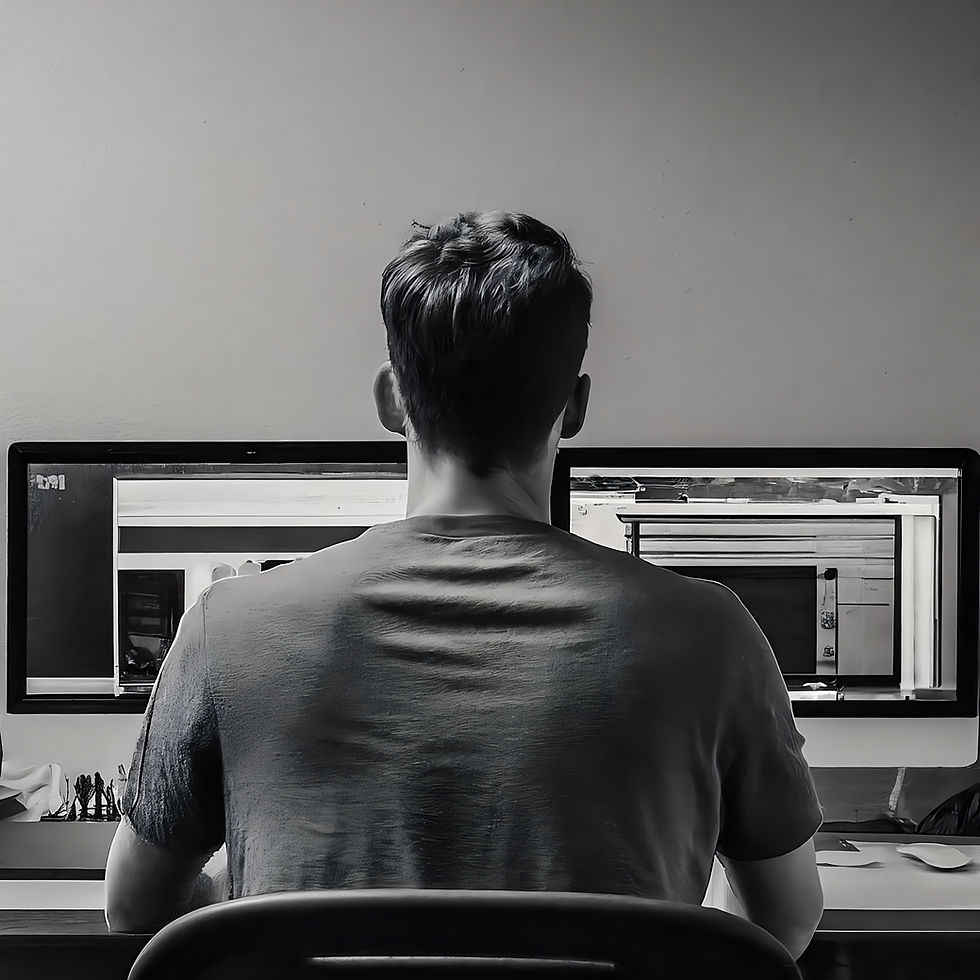
Dr. Mari Swingle, Ph.D. – Swingle Clinic, Vancouver, BC, Kanada
Übersetzt und bearbeitet von Hany Branga – 2025 - Praxis für Ergotherapie und Neurofeedback – Schüttorf
Digitale Medien und psychische Gesundheit
Die sozialen und emotionalen Auswirkungen einer übermäßigen Nutzung digitaler Medien – auch bekannt als i-Technologien oder kurz i-Tech – werden seit Jahren intensiv erforscht.Zahlreiche Studien zeigen Zusammenhänge zwischen exzessivem Medienkonsum und psychischen Störungen wie Depression, Angst oder Zwangsstörungen.
Viele Fachleute vermuten inzwischen, dass die sogenannte i-Sucht keine eigenständige Erkrankung ist, sondern ein Symptom oder eine Verhaltensausprägung anderer psychischer Störungen. Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Umweltfaktoren scheinen die Entwicklung problematischer Nutzungsmuster zu begünstigen.
Zudem leiden Betroffene häufig unter weiteren psychischen oder sozialen Schwierigkeiten (vgl. Caplan & High; Pies, 2009; te Wildt et al., 2010; Young & Nabuco de Abreu, 2011).
Neue Phänomene der digitalen Ära
Digitale Medien können bestehende psychische Erkrankungen nicht nur verstärken, sondern offenbar auch neue, technologieabhängige Störungsbilder hervorrufen.Dazu zählen beispielsweise:
Cyberchondrie – übermäßige Online-Suche nach Krankheitssymptomen
FOMO („Fear of Missing Out“)
Phantom-Vibrations-Syndrom – die fixe Überzeugung, das Telefon vibriere, obwohl es das nicht tut
Auch Verhaltensweisen wie Voyeurismus oder soziopathischer Narzissmus treten häufiger auf (Rossen, 2012).
Neurobiologische Grundlagen der i-Sucht
Mehrere Studien zeigen, dass i-Sucht, insbesondere Computerspielsucht, ähnliche neurochemische und neuronale Veränderungen aufweist wie stoffgebundene oder andere Verhaltenssüchte (vgl. Swingle, 2015).
In meiner eigenen Forschung habe ich mittels EEG-Messungen untersucht, ob i-Sucht eine eigenständige Störung ist oder gemeinsame biologische Grundlagen mit ADHS, Depression oder Angststörungen hat.Dabei interessierte mich auch, ob der Suchtfaktor eher vom Prozess (Was man tut, z. B. Spielen, Scrollen) oder von der Motivation (Warum man es tut, z. B. Beruhigung, Stimmungsregulation) abhängt.
Das Ergebnis war eindeutig: Das Warum überlagert das Was. Die Motivation zur Nutzung ist entscheidender als die Art der Nutzung.
Ein bewegliches Forschungsziel
Ein zentrales Merkmal der i-Technologie-Forschung ist ihre rasante Entwicklung. Technologie, Nutzungsmuster und Auswirkungen auf das Gehirn verändern sich schneller, als die Wissenschaft sie erfassen kann.
Vor 10 bis 15 Jahren zeigten sich erste klinische Fälle fast ausschließlich bei Jungen mit exzessivem Gaming-Verhalten. Die Symptome: emotionale Dysregulation und Aufmerksamkeitsprobleme in Schule und Alltag.EEG-Befunde zeigten typischerweise frontale Dysregulationen oder übermäßige Theta-Aktivität, jedoch ohne einheitliche Muster.
Diese Ergebnisse legen nahe, dass übermäßiges Spielen vorhandene Anfälligkeiten aktiviert – im Sinne eines epigenetischen Auslösers.
Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen
Bei Erwachsenen traten vor allem Beziehungsprobleme, vermeidendes Verhalten (z. B. Rückzug in digitale Welten) und Aggressionsschwierigkeiten auf.Auch hier zeigten EEGs keine einheitlichen Muster, sondern breit verteilte Deregulationen – ein Hinweis auf individuelle Vulnerabilitäten.
Damit bestätigen sich frühere Forschungsergebnisse: i-Sucht ist meist komorbid, nicht eigenständig (Swingle, 2013).
Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt im Alter der Erstnutzung:In den frühen 2000ern begannen Kinder meist zwischen 9 und 15 Jahren mit Gaming – mobile Geräte spielten kaum eine Rolle. Erwachsene waren überwiegend Digital Immigrants, die i-Technologien erst im späteren Leben kennenlernten.
Die neue Generation: Digital Natives von Geburt an
Heute sieht die Situation völlig anders aus.Kinder kommen schon im Vorschul- oder sogar Säuglingsalter mit digitalen Geräten in Kontakt. Tablets, Smartphones und Bildschirme sind allgegenwärtig.
Diese frühe und umfassende Nutzung verändert die Entwicklung tiefgreifend – auch messbar im EEG:Jüngere Menschen unter 30 Jahren zeigen häufig Alpha-Deregulationen, die auf eine strukturelle Veränderung neuronaler Systeme hinweisen.
i-Technologie scheint also nicht nur kurzfristige Effekte auf Aufmerksamkeit, Verhalten und Stimmung zu haben, sondern kann diese Systeme neu verdrahten – und bei sehr jungen Kindern sogar die Gehirnentwicklung selbst beeinflussen.
Auswirkungen auf Bindung und Lernen
Immer mehr Forschung deutet darauf hin, dass frühe Bildschirmnutzung die sozio-emotionale und kognitive Entwicklung verändert – insbesondere die Bindungsentwicklung.
Säuglinge benötigen für ihre neurologische und emotionale Reifung unmittelbare Interaktion mit Bezugspersonen.Digitale Geräte ersetzen diese Interaktion jedoch oft, anstatt sie zu ergänzen. Dadurch bleiben wichtige Bindungs- und Kommunikationssysteme ungenutzt.
Im Gegensatz zu traditionellen Spielzeugen wirken i-Technologien exklusiv statt additiv:Wenn Kinder mit Bildschirmen beschäftigt sind, interagieren sie weniger mit ihrer Umgebung – was ihre Beobachtungsgabe, Neugier und Erkundungsfreude hemmt (vgl. Gopnik).
Zahlreiche Studien, vor allem zum Spracherwerb, zeigen, dass bildschirmbasierte Medien das Lernen eher behindern als fördern (vgl. Kuhl; Zimmerman, Christakis & Meltzoff, 2007).Auch die zunehmende emotionale Bindung älterer Kinder an Gleichaltrige – bei gleichzeitiger Abnahme elterlicher Präsenz – hat tiefgreifende Folgen für die emotionale Entwicklung (Lamb & Brown, 2006; Neufeld & Mate, 2004).
Hinzu kommt: Kinder mit intensiver i-Tech-Nutzung zeigen eine verringerte Fähigkeit, nonverbale Signale und Gesichtsausdrücke zu lesen (Uhls et al., 2014) – möglicherweise ein Risikofaktor für autistische Merkmalsentwicklungen.
Forschungslücken und kritische Perspektiven
Über die Wirkungen digitaler Geräte auf Säuglinge ist bisher wenig bekannt.Viele aktuelle Studien fokussieren eher darauf, welche Aspekte der Technologie Säuglinge anziehen oder welche Gesten sie intuitiv verwenden – was eher an Produkt- als an Entwicklungsforschung erinnert (Cristia & Seidl, 2015).
Ursprünglich wurde Tablet-Technologie für nicht-menschliche Primaten und Menschen mit schweren Kommunikationsstörungen entwickelt – mit großem Erfolg.Doch wenn solche Technologien nun alltäglich für Kleinkinder werden, sollten wir uns fragen:Welche Botschaft senden wir – und welches Ziel verfolgen wir?
Bindung als biologische Grundlage der Entwicklung
Aus jahrzehntelanger Entwicklungsforschung wissen wir:Die direkte, herz-zu-herz-basierte Interaktion zwischen Eltern und Kind bildet das Fundament aller späteren Beziehungs- und Selbstregulationssysteme.
Fehlt diese Interaktion – durch mangelnde Nähe, Berührung oder Aufmerksamkeit – bleiben neuronale Netzwerke unentwickelt.Dieser Prozess, bekannt als neuronaler Darwinismus, bedeutet, dass ungenutzte synaptische Verbindungen abgebaut werden.
Die frühe und intensive Nutzung digitaler Geräte kann somit das grundlegendste biologische System beeinflussen, das die Entwicklung des Menschen trägt:das Bindungssystem (vgl. Ainsworth & Shore; Siegel & Porges, 2011).
Über die Autorin
Dr. Mari Swingle ist Autorin von i-Minds (2015), Gewinnerin des 2015 Federation of Associations in Behavioral & Brain Sciences Early Career Impact Award, klinische Therapeutin an der Swingle Clinic in Vancouver und international anerkannte Referentin über die neuropsychologischen Auswirkungen digitaler Technologien.
---
Literaturangaben
Ainsworth, M.D., Blehar, M.C., Waters, E. & Wall, S. (1978). Bindungsmuster. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Caplan, S.E. (2003). Preference for Online Social Interaction: A Theory of Problematic Internet Use and Psychosocial Well-Being. Communication Research, 30, 625–648.
Caplan, S.E. & High, A.C. (2011). Online Social Interaction, Psychological Well-Being, and Problematic Internet Use. In K.S. Young and C.N. Nabuco de Abreu (Eds.), Internet Addiction (pp. 35–54). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Cassidy, J. and Shaver, P.R. (Eds.). (1999). Handbook of Attachment. NY, NY: Guilford Press.Cristia, A., Seidl, A. (2015). Reports from Parents on Touchscreen Use in Early Childhood. PLoS ONE 10(6): e0128338. doi:10.1371/journal.pone.0128338
Gopnik, A., Meltzoff, A., & Kuhl, P. (1999). The Scientist in the Crib: What Early Learning Tells Us About the Mind. NY, NY: Harper Collins.
Kuhl, P.K. (2007). Is Speech Learning Gated by the Social Brain? Developmental Science, 10(1), 110–120.
Kuhl, P.K., Tsao, F-M., & Liu, H-M. (2003). Foreign-Language Experience in Infancy: Effects of Short-Term Exposure and Social Interaction on Phonetic Learning. PNAS, 10(15), 9096–9101.
Lamb, S. & Brown, L.M. (2006). Packaging Girlhood. NY, NY: St. Martin’s Press.Neufeld, G., & Mate, G. (2004). Hold On to Your Kids. Toronto, Canada: Random House.Pies, R. (2009). Should DSM-V Designate “Internet Addiction” a Mental Disorder? Psychiatry, 6(2), 31–37.
Porges, S. (2011). The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation. NY: W. W. Norton & Company.Rossen, L. (2012). iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and Overcoming Its Hold on Us. NY, NY: Palgrave Macmillan.
te Wildt, B.T., Putzig, I., Drews, M., Lampen-Imkamp, S., Zedler, M., Weise, B., Dillo, W. & Ohlmeier, M.D. (2010). Pathological Internet Use and Psychiatric Disorders. The European Journal of Psychiatry, 24(3).
Seigel, D. J. (2001). Toward an Interpersonal Neurobiology of the Developing Mind. Infant Mental Health Journal, 22(1–2), 67–94.
Shore, A. (2001). Effects of Early Relationship Trauma on Right Brain Development, Affect Regulation, and Infant Mental Health. Infant Mental Health Journal, 22(1), 201–269.
Swingle, M. (2013). Electroencephalographic (EEG) Brain Mapping Patterns in a Clinical Sample of Adults Diagnosed with Internet Addiction. Doctoral Dissertation.
Swingle, M. (2015). i-Minds: How Cell Phones, Computers, Gaming, and Social Media Are Changing Our Brains, Our Behavior, and the Evolution of Our Species. Portland, OR: Inkwater.
Young, K.S., & Nabuco de Abreu, C. N. (Eds.). (2011). Internet Addiction. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Uhls, Y.T., Michikanyan, M., Garcia, J., Small, G.W., Zgourou, E., & Greenfield. (2014). Five Days at Outdoor Education Camp Without Screens Improves Preteen Skills with Nonverbal Emotion Cues. Computers in Human Behavior, 39, 387–392.
Zimmerman, F.J., Christakis, D.A., & Meltzoff, A.N. (2007). Television and DVD/Videoviewing in Children Younger Than 2 Years. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.


Kommentare